Wer den Weg der Wahrheit geht, stolpert nicht. -Mahatma Gandhi –
Liebe Freunde, liebe Leser,
Elisabeth ist die Person, die ich aus dem Roman streichen musste. Mit 444 Seiten wäre es im Selbstverlag zu teuer geworden. Aber Elisabeth ist eine wichtige Figur, weshalb sie hier nun als Fortsetzungskurzgeschichte erscheinen wird. Teil 1:
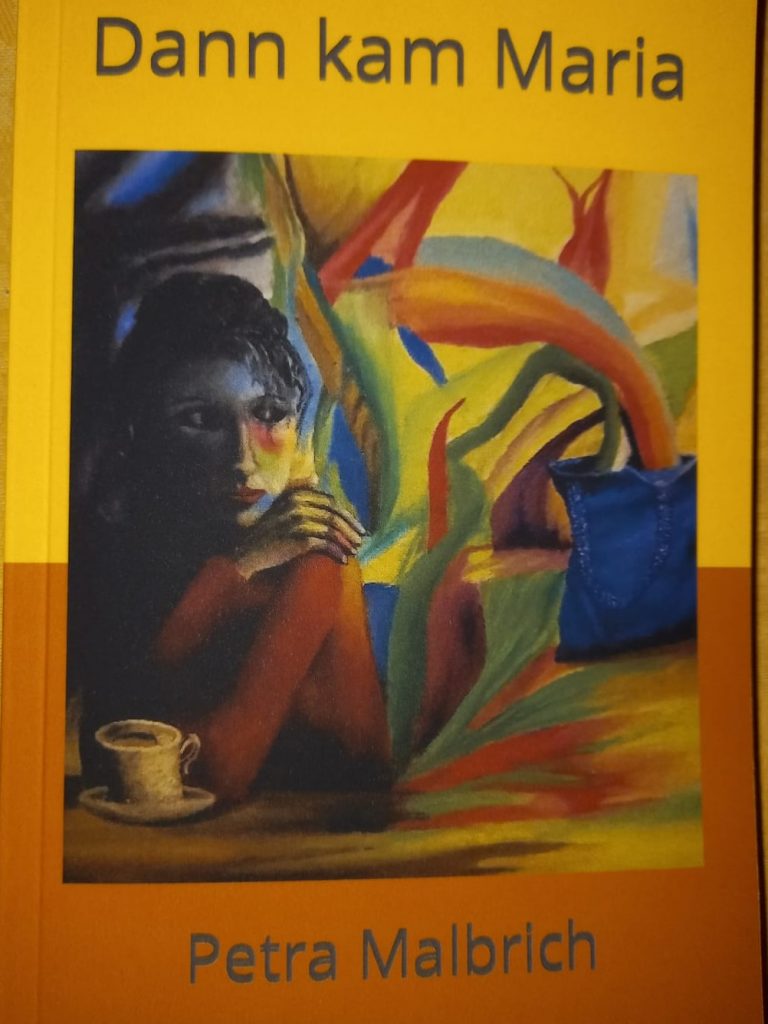
Es gab Tage, da passte selbst der Klingelton des Telefons zur Stimmungslage des Gemüts. Elisabeth Singer hatte ihr Büro schon verlassen, als das Telefon schrillte. Eindringlich klang es. Hilferufend. Eilig kehrte sie um, hastete zu ihrem Schreibtisch und konnte den Hörer gerade noch abnehmen, bevor es wieder verstummt wäre.
„Wolltest du nicht Feierabend machen? Ach, ich habe vergessen, du bist ein guter Mensch“, meinte ihr Kollege Christian Klein etwas ironisch.
Elisabeth forderte Christian mit einer hektischen Handbewegung zum Schweigen auf.
„Jugend- und Sozialamt. Elisabeth Singer“, meldete sich Elisabeth.
„Die Mama redet nicht mehr!“ Dann weinte das Mädchen am anderen Ende der Leitung.
Genau das hatte Elisabeth befürchtet, als sich den ganzen Tag noch niemand bei ihr gemeldet hatte und deshalb war sie gerade auf dem Weg zu Familie Homann.
Auch ohne dass es ihren Namen nannte, erkannte Elisabeth die Stimme des Mädchens. Marie hieß sie, war fünf Jahre alt und eigentlich doch viel reifer. Vor drei Monaten wurde Elisabeth, die als Bezirkssozialarbeiterin arbeitete, dieser Fall übertragen.
„Bleibe bei ihr. Ich rufe einen Arzt und komme sofort zu dir“, antwortete Elisabeth. Sie griff nach ihrem Autoschlüssel, den sie auf den Schreibtisch geworfen hatte und wollte das Büro wieder verlassen.
Christian schaute fragend.
„Maries Mutter ist wohl etwas zugestoßen. Ich muss sofort zu ihnen fahren“, erklärte Elisabeth hastig.
„Dein Engagement in Ehren. Du erledigst deinen Job mit Herzblut. Aber findest du das nicht ein wenig übertrieben? Immerhin ist das keiner unserer Fälle mehr. Du hast ihn abgeschlossen“, meinte Christian.
„Ich habe den Fall beiseite gelegt, weil es keine weitere gesetzliche Grundlage gab, aber ich habe den Fall nicht abgeschlossen. Die beiden haben niemanden. Also hör auf, dich zu mokieren und komm mir jetzt nicht wieder mit deinem Geschwätz über mein Gutmenschentum“, schimpfte Elisabeth.
„Ich rege mich nicht auf. Ich warne dich. Du lehnst dich wieder einmal zu weit aus dem Fenster. Wenn ich nicht so nett wäre, würde ich sagen, du mischt dich immer noch in Dinge ein, die dich nichts mehr angehen. Vor einem halben Jahr war es die Seniorin, die dich Tag und Nacht eingenommen hat, bis du nicht nur am Rande eines Nervenzusammenbruchs warst, sondern auch noch mächtige Unannehmlichkeiten mit den Angehörigen hattest. Nun ist es die junge Mutter mit dem Kind. Woher willst du wissen, dass sie niemanden haben? Pass auf, dass du, die überall die Retterin sein will, nicht einmal selbst Rettung brauchst.“
Elisabeth verzog den Mund.
„Dann weiß ich ja, an wen ich mich wenden muss. Wie würde denn die Welt aussehen, wenn jeder mit dem Gongschlag zum Feierabend die Akten in die Schublade steckt? Für mich jedenfalls ist das mehr als ein Job. Ich will ein guter Mensch sein und das stünde dir auch gut“, konterte Elisabeth. “
Solche Sticheleien waren typisch für ihren Kollegen. Bei ihm hörte das Mitleid mit der Stechuhr auf. Zeigte die Uhr Dienstschluss, waren die Menschen vergessen. Elisabeth wollte den Menschen mehr geben als amtliche Unterstützung. Die Menschen brauchten einen Halt, eine Hoffnung, eine Zuversicht. Davon war Elisabeth überzeugt. Zu viele Fälle, wie es ihr Kollege nüchtern bezeichnete, waren froh, dass sie mit Elisabeth eine Freundin an ihrer Seite hatten. Einen Menschen, der ihnen Trost spendete.
Christian lachte.
„Woher weißt du, wie ein guter Mensch sein muss? Sind alle, die anders handeln als du schlechte Menschen?“
„Für diese Debatte ist jetzt keine Zeit“, meinte Elisabeth gereizt, schlug die Bürotür zu, rannte zum Parkplatz und startete ihr Auto.
Unterwegs informierte sie den Rettungsdienst. Was vorgefallen war, wusste Elisabeth zwar noch nicht. Aber schon vor drei Monaten hatte Julia Homann Selbstmordgedanken angedeutet. Zumindest hatte Elisabeth das so interpretiert.
„Ich schaffe das einfach nicht mehr“, hatte Julia Homann bei Elisabeths ersten Besuch in der Familie gesagt. Die junge Frau kam Elisabeth selbst noch wie ein Kind vor, obwohl sie bereits Anfang Zwanzig war. Ihr Gesicht war mit Sommersprossen übersät. Die braunen Augen passten zu ihrem roten Haar. Beides wirkte temperamentvoll, als würden Funken sprühen. Umso konträrer war das zu Julias Mattigkeit und Niedergeschlagenheit. Sie war mehr in dem Stuhl gelegen als gesessen. Auf ihrem Schoß saß Marie. Sie hatte ein rotes Lockenköpfchen, Sommersprossen um die Nase herum und war rein äußerlich die perfekte Kopie ihrer Mutter. Nur in Maries Augen spiegelte sich ein goldenes Funkeln, das Neugierde und Freude ausdrückte. Ein Funkeln, das in Julias Augen bereits erloschen war. Zu viel Elend hatte die junge Frau bereits gesehen. Sie war auf einem weißen Holzstuhl, mit einer Flechtsitzfläche gesessen. So, wie es jetzt als Landhausstil wieder modern wurde. Allerdings waren Julias Möbel keine Neuanschaffungen, sondern Möbel, die andere Leute sonst in den Sperrmüll gegeben hätten. Der Stuhl, auf dem Elisabeth gesessen hatte, war ein Stuhl mit Samtbezug und einem braunen Holzgestell. Zwei einfache Holzstühle gehörten noch zu dieser Sitzgruppe. Schon diese bunte Zusammenstellung war ein Spiegelbild der gesamten Wohnung. Kein Möbel passte zum anderen, denn allesamt waren gebraucht. Teils auch schon verbraucht, wie Julia, hatte Elisabeth bei dem ersten Treffen gedacht. Die junge Frau schämte sich für die minderwertige Wohnungseinrichtung, konnte Elisabeth erkennen. Julia jedenfalls versuchte, die Räume gemütlich einzurichten. Ein paar zerfledderte Bücher lagen auf dem Tisch. Ein Bilderbuch für Marie, ein Romanheft für Julia. Es war einer dieser Liebesromane, die es am Kiosk zu kaufen gab. Etwas, das ihre Sehnsucht befriedigen sollte, kam Elisabeth beim Anblick des Heftchens in den Sinn. Eine einzelne Grünpflanze stand auf dem Fensterbrett. Grün war das satte Leben und das war in der Wohnung nur spärlich vorhanden. Aber es gab Leben. Es gab Hoffnung, dachte Elisabeth und nahm damals dankend die Einladung zum Tee an.
Julia achtete auf Sauberkeit und sie war liebevoll zu ihrer Tochter. Während Marie auf Julias Schoß saß und Elisabeth schüchtern, aber interessiert begutachtete, küsste Julia immer wieder den Kopf ihres Mädchens und strich ihr über das Haar. Als Marie heruntergerutscht war, um im Wohnzimmer eine Puppe aus der kaputten Plastikkiste zu ziehen, begann Julia zu weinen. Die Ärmel ihres Pullis reichten weit über das Handgelenk. Es war ein gestrickter Pulli. Einer, den sie aus der Altkleidersammlung gezogen hatte.
„Wenn es dunkel wird, stöbere ich die Tüten manchmal durch. Die Container sind nicht immer richtig verschlossen“, hatte Julia entschuldigend gesagt und dabei gegrinst. Das war einer der seltenen Momente. Viel häufiger war sie schwer depressiv und zitterte. So interpretierte es Elisabeth. Julia konnte nicht mehr zur Ruhe kommen. Sie war acht Jahre alt gewesen, als sie sich unter dem Tisch versteckt hatte, weil ihr Vater wieder ausgerastet war. Er war ein aggressiver Mensch, was durch seine Minderwertigkeitsgefühle noch verstärkt wurde, brüllte nicht nur jeden in Grund und Boden, sondern schlug nach einem Kneipenbesuch auch mal zu. An einem Sonntagnachmittag war er von einem Freund verspottet worden und hatte ein Ventil gesucht, das er zu Hause fand. Seine Frau war am Herd gestanden, um sein Essen aufzuwärmen. Wenn er wollte, hatte er immer einen Grund zum Nörgeln gefunden. Egal was seine Frau geantwortet hätte, es wäre falsch gewesen. So war er auch an jenem Sonntag aufgestanden, hatte seine Frau angepöbelt und dann gegen den Herd geschubst. Sie hatte das Gleichgewicht verloren, hatte am Herd Halt gesucht, nur den Pfannenstil erwischt und die Pfanne heruntergerissen. Sie war blutend am Boden gelegen, die schwere Gusseisenpfanne hatte sie am Kopf getroffen. Im Krankenhaus war sie an den Folgen des unglücklichen Unfalls gestorben. Julias Vater war das Sorgerecht entzogen worden. Von da an hatte Julias Odysee begonnen. Sie war zunächst zu Pflegeeltern und dann ins Kinderheim gekommen und umgekehrt. Die Bilder ihrer hilflos am Boden liegenden Mutter hatte sie noch immer im Kopf. Julia war ein verschüchtertes Mädchen. Jeder konnte das aus zehn Kilometer Entfernung sehen. Bei jedem lauten Geräusch zuckte sie zusammen.
Nie hatte sie protestiert und wenn, dann war jeder Versuch im Keim erstickt worden. Auch im Heim war sie als Spielball von dominanteren Mitbewohnern missbraucht worden. Sie war fünfzehn Jahre alt gewesen, als sie sich von den honigsüßen Worten ihres Mitschülers Patrick einwickeln ließ. Er hatte ihr die heile Welt versprochen, die sich Julia seit jeher erträumt hatte. Stattdessen war sie schwanger geworden, wurde beschimpft und musste ein Zimmer im Mädchenwohnheim beziehen. Dort waren andere jugendliche Mütter. Wobei Julia sie nicht als Mütter hatte bezeichnen wollen. Mit dem Wort Mutter verband das Mädchen eine Frau, die sich kümmerte, die in die Arme nahm, die einfach da war, wenn sie gebraucht wurde. So wie ihre Mutter da war, als sie noch lebte. Die jungen Mütter aus dem Heim waren anders. Sie waren kalt, egoistisch, unfair und genauso unberechenbar und verletzend wie Julia die Mitbewohner und Erzieher aus dem Heim kannte. Sie waren wie die Eltern, die sie zu diesen Menschen machten. Julia wollte eine andere Mutter sein. Sie hatte in einem Supermarkt gejobbt und bei einer gesellschaftlich angesehenen Familie geputzt. Dass diese Julias Naivität auskosteten, um eine billige Arbeitskraft zu haben, war der jungen Frau bald bitter vor Augen geführt worden. Als die Familie Julia nicht mehr gebrauchen konnte, hatten sie Julia des Diebstahls bezichtigt. Dabei war sie so stolz gewesen, sich und ihre Tochter mit dem selbstverdienten Geld in einer vom Amt zugewiesenen Einzimmerwohnung versorgen zu können. Julia hatte vor Gericht keine Chance gehabt und galt von dem Zeitpunkt an als vorbestraft. Sie würde beobachtet werden. Elisabeth war eingeschaltet worden, sich um die junge Frau zu kümmern und ein Auge auf deren kleine Tochter zu werfen. Julia war am Boden zerstört, denn damit war ihr unterstellt worden, sie würde ihre Tochter gefährden. In gewisser Weise hatte das auch gestimmt, musste sich Elisabeth eingestehen. Denn wenn sie zu einer Familie geschickt wurde, musste sie entscheiden, ob Kinder, hilfsbedürftige Senioren oder beeinträchtigte Menschen gut behandelt wurden oder aus der Familie genommen werden sollten.
Schon beim ersten Treffen konnte sich Elisabeth vom Gegenteil überzeugen. Julia grundlos das Kind zu nehmen, wäre einer Katastrophe gleichgekommen.
„Ich weiß, ich bin kein kluger Mensch. So gut waren meine Noten nicht und ich habe oft nicht verstanden, was die Lehrer von mir wollten. Doch wenn sie mir wieder etwas anhängen wollen und mir deshalb meine Marie nehmen, dann will ich nicht mehr leben. Dann kann ich nicht mehr leben“, hatte Julia damals gesagt. Mit „sie“ bezeichnete Julia alle Menschen, die beruflich oder gesellschaftlich eine Stufe über Julia standen.
Elisabeth hatte diesen unausgesprochenen Hilferuf und die Verzweiflung der jungen Frau noch deutlich im Ohr und sie hatte das ernst genommen.
Wollte jetzt jemand Julia etwas anhängen? Hatten sich Nachbarn beschwert? Hatten sie der armen Frau die Polizei geschickt?
Wieder etwas anhängen, hatte Julia so lapidar dahingesagt. Als würde es selbstverständlich sein, Menschen wie Julia, die zur unteren Gesellschaftsschicht, zu den Unsozialen, zu den Problemfällen gehörten, „etwas anzuhängen.“ Damit die besseren Menschen der Gesellschaft eine weiße Weste behielten.
Noch immer ärgerte sich Elisabeth über diese Einstellung mancher Menschen, gerade wenn sie an die ersten Treffen mit Julia dachte und daran, wie schutzbedürftig und tapfer zugleich die junge Frau war.
Leider war es Elisabeth unmöglich, zu Julia die beruflich geforderte Distanz zu wahren. Hatte Christian recht? Hätte sie die Akte einfach schließen sollen, nachdem keine Gefährdung erkennbar war? Wollte sie ihre Retterin sein? Ihre Freundin? Was war falsch daran?
Elisabeth glaubte, inzwischen ein untrügliches Gefühl entwickelt zu haben, welcher ihrer Schützlinge wirklich Schutz bedurfte und einfach nur ein Opfer seiner Lebensumstände geworden war und wer von ihren Klienten nicht mehr sozialisiert werden konnte.
Sie ist nicht mehr dein Fall, hallte Christians Bemerkung in Elisabeths Ohren nach.
So viele gescheiterte Existenzen, bevor das Leben richtig begonnen hatte. Und so oft waren diese Menschen unverschuldet in diese Situation gedrängt worden. Elisabeth schüttelte den Kopf bei den vielen Beispielen, die sie während ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin kennengelernt hatte.
Wenn Kinder durch einen Unfall plötzlich Waisen wurden und sich keine Verwandten als Sorgeberechtigte fanden, mussten sie ins Heim. Wohngruppe lautete die nun wohlklingendere Bezeichnung. Am Lebenslauf änderte das oft wenig. Stille und zaghafte Menschen wurden unterbuttert von den stark auftretenden Menschen, die keine Regeln und Grenzen kannten. Die wenigen Erzieherinnen waren oft heillos überarbeitet. Manche auch überfordert. Julia gehörte zur ersten Menschengruppe und sie und ihre kleine Marie waren aller Mühe wert.
Elisabeth seufzte, setzte den Blinker und bog in die Straße ein, die direkt zu Julias Wohnblock führte. Das Blaulicht am Rettungswagen war verstummt. Die Tür stand offen. Eine Frau, wohl die Fahrerin, sprach in das Funkgerät. Sie nickte, als Elisabeth an ihr vorbei in den Hauseingang lief. Im Erdgeschoss war Julias kleine Wohnung. Eigentlich war es nicht mehr als ein Wohnschlafzimmer mit einer kleinen Kochnische und einem ebenso winzigen Badezimmer, in dem gerade ein Waschbecken und eine Dusche Platz fanden.
Die Wohnungstür stand offen. Weiter oben im Treppenhaus schaute ein älterer Herr übers Geländer nach unten zum Eingang. Ansonsten blieb es still hinter den Wohnungstüren, die zumeist in ebenso kleine Ein- und Zweizimmerwohnungen führten, wie sie Julia bewohnte. Die Stille im Treppenhaus spiegelte die Anonymität in dem Wohnblock wider. Somit gab es nur wenig Hilfsbereitschaft untereinander. Niemand wollte in das Leben, in die Sorgen und den Umgang der anderen hineingezogen werden.
Obwohl die Tür offen stand, klopfte Elisabeth leise an. Sehen konnte sie nichts. Der Notarzt kniete bei Julia, legte einen Tropfer. Die junge Mutter wurde versorgt, was wiederum bedeutete, dass sie noch lebte. Elisabeth war erleichtert. Sie drängte sich an den Rettungskräften vorbei, während sie nach Marie suchte. Die Sanitäter hinderten Elisabeth nicht daran. Sie war bekannt und einer der beiden Sanitäter, der seinen Blick zwischendurch zu Marie schweifen ließ, schien erleichtert, als Elisabeth kam und sich nun dem Mädchen widmete. Völlig verschüchtert hockte sie zusammengekauert in der Ecke bei der Garderobe. Ihre Puppe hatte sie eng an sich gedrückt. Sie blieb stumm, versuchte sich unsichtbar zu machen, um nicht weggeschickt zu werden. Wie ein Luchs beobachtete sie haarscharf, was mit ihrer Mutter geschah. Und doch blickte die nackte Angst aus ihren Augen. Auf Zehenspitzen schlich Elisabeth zu Marie, setzte sich neben das kleine Mädchen und legte tröstend den Arm um sie.
„Deine Mama wird nun gut versorgt. Sie wird wohl ins Krankenhaus müssen, damit sie bald wieder ganz gesund ist. Dann ist sie wieder bei dir“, flüsterte Elisabeth dem Mädchen ins Ohr.
Verständnisvoll wie eine Erwachsene, nickte Marie. Sie drückte die Puppe fester an sich. So fest, wie sie nun gerne bei ihrer Mutter wäre.
Wie sollte Elisabeth ihr erklären, dass sie während der Zeit des Krankenhausaufenthalts zu einer Pflegefamilie kam? Was würde dann passieren? Würde eine gerichtliche Entscheidung getroffen werden, dass Marie für eine längere Zeit bei der Familie bleiben sollte? Weil Julia noch nicht kräftig genug war? Weil Marie ein geregeltes Leben erfahren sollte? Elisabeth wusste noch nicht einmal, was passiert war. Wenn Julia sich wirklich das Leben nehmen wollte, dann wäre es unwahrscheinlich, dass sie ihre Tochter behalten dürfte. Elisabeth wiegte das verängstigte Mädchen hin und her, fest umarmt, als könnte sie ihr damit die Folgen ersparen.
„Kannst du mir sagen, was passiert ist?“, flüsterte Elisabeth.
Marie nickte.
„Mama hat in den Kühlschrank geschaut und ist dann einfach umgefallen.“ Marie zwinkerte die Tränen weg, hielt ihre Puppe noch fester.
FORTSETZUNG FOLGT
